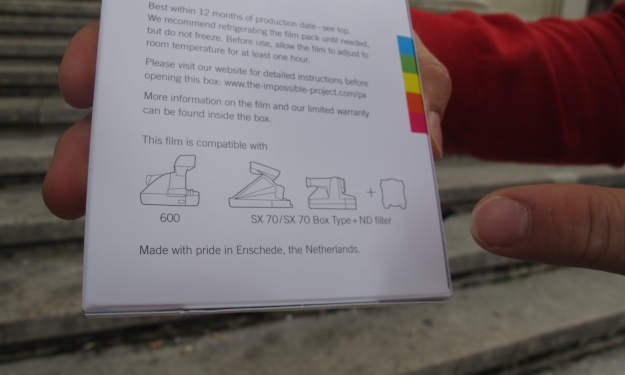Indien ist ein gigantischer Spiegel. Jeder darf hineinblicken und sich anschauen. Wer das Land im selben Zustand verlässt, wie er es betreten hat, kam schon als Leiche.
Diese Sätze von Andreas Altmann aus seinem Buch Triffst du Buddha, töte ihn!: Ein Selbstversuch lassen mich seit dem ersten Lesen nicht mehr los. Sie haben mich in das Land begleitet, das der Reiseschreiber-Gott – wie ich ihn immer noch gern nenne – in einem Selbstversuch bereist hat. Ich bin auf seinen Spuren unterwegs oder vielmehr auf meinen, denn schließlich ist es ja meine Reise, mein Indien, MEIN Spiegel.
“Wien, ach da habe ich eine Geschäftspartnerin in der Wipplingerstraße”, verkündet der Mann mit weißem Turban und rot gefärbtem Bart stolz. Im feinsten Deutsch hat er mich angesprochen und gleich seine Lokal-Kenntnisse kund getan. Daneben plaudert ein jüngerer Inder in klassisch gebügeltem, lila Hemd mit Michaela auf Spanisch, und David, unser Betreuer von Shanti Travel, darf sich gerade auf Französisch mit einem anderen glatzköpfigen Mann unterhalten. Die drei haben uns angesprochen, als wir gerade – wegen Gegenlicht vergeblich – versucht haben, den rosa Windpalast in Jaipur in seiner ganzen Größe abzufotografieren. Und sie waren nicht die Einzigen. Überall tönt es “komm in mein Geschäft”, “schau doch in meinen Shop”, “mein Lokal ist das Beste”, … mein, mein, mein.

Jeder hat „seines“: Indien ist voller Unternehmer. Foto: Doris
„Wie gehst du mit diesem ständigen Kontakt um?“, frage ich David, der bereits seit 1,5 Jahren in Indien arbeitet und gerade wiederum um ein Jahr verlängert hat (“ich bin mit Indien noch länger nicht fertig”, so die Erklärung). “Das hängt ganz von meiner Stimmung und Einstellung ab”, meint er. Heute scheint die gut zu sein, denn er lässt sich ständig auf ein Gespräch ein, beeindruckt die Inder mit seinen Brocken Hindi, erzählt von seiner jetzigen “Heimat” Delhi und nimmt sogar die Einladung zum Chai an, die wir von den oben erwähnten Geschäftsmännern erhalten. Sie haben uns aufs Dach ihres Geschäftshauses gebeten, um einen besseren Blick auf den Windpalast zu bekommen – und natürlich, um uns später ihre 100%ige Kaschmir-Ware zu zeigen. Wir lehnen ab: Ein Geschäft machen sie mit uns diesmal nicht. Auch kein anderer der Geschäftsleute, von denen Indien voll zu sein scheint. “Gib mir ein bisschen von deiner Zeit”, lockt einer und fügt mit einem Grinsen hinzu: “Und gib mir dein Geld.” Sie sind ganz schön direkt, die Inder.

Zu Chai wird gern geladen – er wird aber auch verkauft. Foto: Doris

Handleser und Wahrsager dürfen natürlich auch nicht fehlen. Foto: Doris
Eineinhalb Tage bin ich jetzt im Land. Ich bin mit enormen Respekt hierher gekommen. “Auf Indien kannst du dich nicht vorbereiten”, “Indien ist intensiv”, “überall riecht es nach Pisse”, “ausgestiegen, und schon hat mir eine Frau ihr Baby in den Arm gedrückt”, “bei der Bushaltestelle lag eine verweste Hundeleiche”… Aussagen und Schilderungen wie diese haben mich auf dem Flug hierher begleitet. Ich bin sicher, sie stimmen alle – oder fast alle, denn nach Pisse riecht es nur streckenweise.

Indien ist ein brutales Pflaster, keine Frage. Foto: Doris
Und auch wenn mir noch kein Kind überreicht wurde (okay, fast, aber nur für ein Foto), ist das Unglaubliche überall wahrzunehmen: Unterernährte Kühe grasen in den Müllhaufen auf den Straßen, Kindfrauen duschen sich unter Regenrinnen mit dunkelbraunem, vor Schmutz starrendem Wasser, andere kommen dir mit Stumpen als Gliedmaßen entgegen, Männer klopfen am Straßenrand Steine in kleine Brocken, die Überquerung der Straße ist eine reine Glückssache und das Dauerhup-Konzert dröhnt dir Tag und Nacht in den Ohren. Und keinen Schritt kannst du durch indische Straßen machen, ohne auszuweichen, aus dem Weg zu springen, angerempelt, angesprochen zu werden, angestarrt zu sein – oder anzustarren. Szenen, die mich an Bolivien, Ecuador, Bhutan oder andere Länder erinnern – nur hier ist alles Mehr, Größer, Schneller, Langsamer, .. Unglaublicher. Indien hat die Superlativen scheinbar für sich gebucht.

Alles ist mehr, größer, lauter, … Foto: Doris
“Du kannst nicht einfach nach Hause zurück, das hier macht etwas mit dir”, ist sich David sicher, während wir mehr oder weniger benommen durch die Straßen wanken. Es strengt an, durch eine Großstadt wie Jaipur zu Fuß zu gehen. Ich bin dauermüde. Ich bin überwältigt. Ich bin berührt. Aber ich bin auch überrascht. Nicht unbedingt von den Erlebnissen, sondern darauf, WAS sie mit mir machen. Ich bin nämlich erstaunlich ruhig – oder besser gesagt, erstaunlich im Hier und Jetzt.

Blick von oben auf die Straßen von Jaipur. Foto: Doris
Das Schäkern mit den Händlern, die manchmal für gelernte Europäerinnen wie mich ganz schön auf die Pelle rücken, der Dreck überall, das ewig-und-drei-Tage-lange Warten für die einfachsten Dinge wie das Einchecken in einem Hotel, ja, selbst den ganzen Tag kein Internet zu haben – ich kann alles sehr gut nehmen. Ohne zu werten, ob etwas gut oder schlecht ist. Es ist so, wie es ist. Vielleicht bin ich noch ein bisschen im Schock. Vielleicht ist der entspannte Einstieg, mit Shanti Travel auf einer Tour mit klimatisierten Auto, Fahrer und angenehm-relaxten Kollegen durch Indien zu fahren und sich im Prinzip um nichts Organisatorisches zu kümmern. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bis zur letzten Minute vor dem Abflug noch an anderen Baustellen gearbeitet habe (und schlussendlich nicht mal mehr wusste, was ich überhaupt in den Rucksack gesteckt hatte). Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich alles ertragen kann, so lange ich mit Menschen sprechen kann, solange ich Kontakt habe – und ja, den gibt es ja hier in Indien zuhauf. Vielleicht … ach, ich weiß es nicht, woran es liegt: Aber das Spiegelbild, das mir Indien im Moment gerade zeigt, ist zwar chaotisch-dreckig und kann ganz schön nerven, aber ist zum Großteil absolut liebenswert! Mh, ich hätte es schlechter treffen können…

Indiens idyllische Seite(n): Sonnenuntergang beim Tigerpalast bei Jaipur. Foto: Doris
… werde ich vermutlich auch. Nein, ich mach mir nichts vor, ich hege nicht die Illusion, dass Indien reibungslos abläuft. Dass nichts schief geht. Dass ich immer in meiner Mitte bleibe. Dafür kenne ich mich zu gut. Genau deshalb habe ich wahrscheinlich zum Abschluss das 10-tägige Vipassana-Retreat gewählt. So wie übrigens Altmann auch, wie ich heute gelesen habe: Denn er hat sich ebenfalls bei genau diesem Meditationsseminar 10 Tage hingesetzt, geschwiegen, sich selbst jenen Spiegel noch näher an die Nase gedrückt, den ihm Indien so gern schon vorher hingehalten hat.

Trotz all der Hektk findet doch jeder ein Stück Ruhe für sich. Foto: Doris
Offenlegung: Ich bin 14 Tage mit Shanti Travel auf Blogtrip. Herzlichen Dank für die Einladung. Die Meinungen und Ansichten in der Geschichte bleiben meine eigenen.