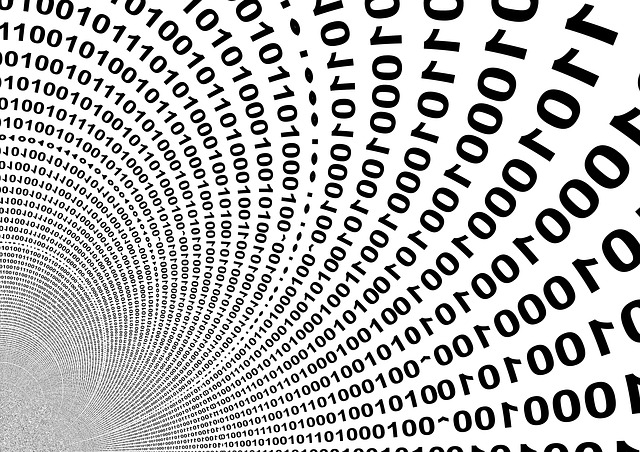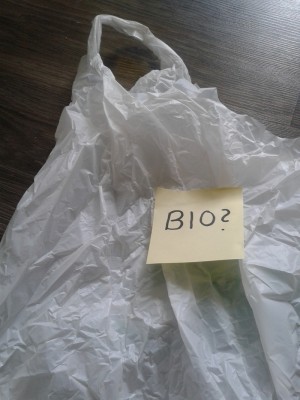Im März habe ich eine Woche als Gast im Kloster „Buddhas Weg“ im malerischen Odenwald (Deutschland, Nähe Weinheim und Heidelberg) verbracht. Wie bin ich darauf gekommen? Dort wo man es…
Im März habe ich eine Woche als Gast im Kloster „Buddhas Weg“ im malerischen Odenwald (Deutschland, Nähe Weinheim und Heidelberg) verbracht.
Wie bin ich darauf gekommen?
Dort wo man es vielleicht am wenigsten erwartet. Letzten Herbst auf dem Oktoberfest in München bin ich zwischen Biergkrügen und Wiesn-Hits mit dem Freund eines Freundes ins Gespräch gekommen. Irgendwie haben wir dann auch über Meditation gesprochen, er hat mir von seinem Aufenthalt in Buddhas Weg erzählt und mir das Kloster weiterempfohlen. In einem Nebensatz meinte er, dass das Essen im Kloster vegetarisch, asiatisch und vor allem sehr lecker ist. Warum also nicht, so dachte ich mir, mal Geist und Körper eine Auszeit gönnen.
Wie ist es mir dabei ergangen?
Sehr gut! Wider Erwarten ist es mir gar nicht schwer gefallen abzuschalten. Dabei geholfen hat mir sicherlich, dass ich mein Handy zwar mit dabei hatte, es jedoch abgeschaltet blieb. Somit habe ich weder Internet, noch E-mails und auch keine Whatsapp-Nachrichten empfangen und auch nicht telefoniert. Zum Lesen habe ich mir ein Buch über buddhistische Psychologie von Jack Kornfield mitgenommen, und eine Freundin hat mir Bücher von Dalai Lama geborgt. Doch ich habe gar nicht so viel gelesen. Die Zeit ist einfach so vergangen, ohne dass mir je langweilig geworden wäre. Im Gegenteil, ich habe es richtig genossen, einmal „Zeit zu haben“.


Wie war der Tagesablauf?
Morgens fand von 5:30 Uhr bis etwa 6:30 Uhr eine ungeführte Morgenmeditation und kurze Rezitation von buddhistischen Versen mit den Nonnen statt. Hier konnte, wer wollte, einfach teilnehmen. Ich war zweimal dabei, sonst habe ich ausgeschlafen, da diese Stunde für mich doch etwas zu früh war. Ich kann zu einer etwas späteren Zeit besser bei der Meditation zur Ruhe kommen, ohne schläfrig zu werden. Um 8:00 Uhr gab es gemeinsames Frühstück und um 12:00 Uhr Mittagessen. Bei diesen beiden Mahlzeiten haben die Nonnen zu Beginn einen Gong geschlagen. Darauf folgte eine kurze Rezitation, in diesem Falle eine Widmung, das heißt Äußerung von Wünschen, die man sich selbst und anderen Menschen und Wesen widmet, um sich der vor sich befindlichen Mahlzeit bewusst zu werden. Danach begann das gemeinsame Essen, die ersten zehn Minuten schweigend und in Achtsamkeit. Nach einem weiteren Gongschlag war die Schweigezeit zu Ende. Teilweise bin ich, wie auch viele der anderen Gäste (zeitgleich mit mir waren in etwa zwanzig bis dreißig Personen im Kloster), alleine an einem Tisch gesessen und habe das sehr leckere Essen schweigend genossen. Es war alles vegetarisch und ein Großteil der Speisen sogar vegan, Mittag- sowie Abendessen waren warm mit verschiedensten Gerichten und alles sehr schmackhaft, asiatisch angehaucht und ich habe mich schon immer darauf gefreut. Manchmal bin ich mit anderen ins Gespräch gekommen, wenn sich jemand neben mich an den Tisch gesetzt hat, und vor allem an meinen letzten Tagen habe ich oft mit einer unterhaltsamen Frau gesprochen. Einige der Gäste nahmen sich auch vor, eine bestimmte Zeit zu schweigen und trugen ein dementsprechendes Schildchen auf der Brust. Abendessen gab es um 18:00 Uhr und um 20:30 Uhr fand eine halbe Stunde ungeführte Abendmeditation statt, für diejenigen die mitmachen wollten.

Am Vormittag und Nachmittag habe ich das gemacht, wonach ich mich gerade gefühlt habe. An den beiden Tagen an denen ich für die Morgenmeditation schon um fünf Uhr früh aufgewacht bin, habe ich mir vor dem Frühstück noch ein Nickerchen gegönnt, sonst teilweise auch am Vormittag oder einfach so nachmittags, wenn ich mich ausruhen wollte. Fast jeden Tag bin ich zwischendurch in die Meditationshalle gegangen, um alleine zu sitzen und zu meditieren – ohne auf die Zeit zu achten, dabei konnte ich oft sehr gut zur Ruhe kommen. Da ich Glück mit dem Wetter hatte und viele sehr sonnige Tage erlebte, war ich jeden Tag im Odenwald, an dem das Kloster direkt liegt, spazieren oder gemütlich laufen und habe mich an der Natur erfreut. Oder ich bin einfach untätig in der Sonne gesessen. Manchmal habe ich in den mitgebrachten Büchern gelesen, wobei es auch im Kloster eine kleine Bibliothek gab.


Montagabend um 19 Uhr wurde Tai Chi angeboten – die beiden Stunden haben mir sehr gut gefallen, die langsamen aber intensiven Bewegungen taten gut und ich konnte im Laufe der Übungen eine starke Energie vor allem im Bauchbereich und in den Händen spüren. Dienstag -, Mittwoch- und Donnerstagabend gab es geführte Meditationen von bis zu zwei Stunden. Diese waren für mich sehr bereichernd, ich habe für mich neue Techniken zur Entspannung gelernt, und meine Meditationspraxis damit aufgefrischt und erweitert. Sehr gut gefallen hat mir zum Beispiel auch die Geh-Meditation, bei der ich meine Gedanken sehr leicht abschalten und mich auf meinen Atem und das langsame bewusste Gehen konzentrieren konnte.
Das Kloster hat auch eine TCM-Praxis (Traditionelle Chinesische Medizin), wo Akupunktur und verschiedenste Massagen angeboten werden. Da ich vorher schon wochenlang von Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich geplagt worden bin, habe ich mir eine Dorn-Breuß-Massage zur Begradigung und Stabilisierung der Wirbelsäule geben lassen, die meinem Rücken wahnsinnig gut getan hat. Am Wochenende hat das asiatische Teehaus des Klosters mit Terrasse und einem Teich mit Goldfischen geöffnet (früher bevor das Kloster das Gebäude übernommen hatte, befand sich in dem Raum ein kleines Schwimmbecken). Es gibt verschiedenste Teesorten und leckeren selbstgebackenen Kuchen und im Hintergrund läuft leise Musik – ein sehr netter Ort zum Entspannen.


Welche Möglichkeiten für einen Aufenthalt in Buddhas Weg gibt es?
So wie ich kann man einfach als Gast kommen und den Tag so verbringen, wie man möchte. Es gibt aber auch viele Seminare und Kurse, die im Kloster abgehalten werden, wie zum Beispiel QiGong, Meditations-Workshops, Yoga-Wochenenden, Wanderungen, verschiedene Vorträge, Klangreisen, Achtsamkeits-Seminare und vieles mehr. Eine Übersicht findet ihr auf der Internetseite von Buddhas Weg: buddhasweg.eu
Ich habe mich bewusst dafür entschieden, kein Seminar zu besuchen, da ich sonst ein sehr aktiver Mensch bin und einmal nicht verplant sein wollte. Dann gibt es noch die Möglichkeit als Helfer ins Kloster zu kommen – egal ob für ein paar Tage oder Wochen. Hier arbeitet man für ungefähr sechs Stunden pro Tag im Kloster mit, zum Beispiel in der Küche, oder beim Saubermachen und Putzen (keine Sorge, für die Gästezimmer gibt es ein eigenes Putzpersonal), oder im Garten. Dafür bekommen die Helfer die Mahlzeiten und Übernachtung frei (diese im unrenovierten Teil des Gebäudes, das soll aber auch in Ordnung sein).
Insgesamt kann ich einen Aufenthalt in Buddhas Weg allen weiterempfehlen, die sich gerne eine Auszeit vom Alltag nehmen wollen, um dann etwas von der Entspannung und den guten Gefühlen wieder mit nach Hause zu nehmen. Und es der Nonne Hue Nghiem gleich tun, die auf die Frage antwortete, was sie macht, wenn ihr die Arbeit zu viel wird: Sofort damit aufhören und auf ihr Zimmer gehen und entspannen. Das wird im Arbeitsalltag schwierig, doch zum Beispiel Zeit für eine Tasse Tee, eine kurze Pause, ein paar langsame achtsame Schritte, ein paar bewußte Atemzüge, um Ruhe zu finden, sollten auch außerhalb eines Klosters möglich sein.