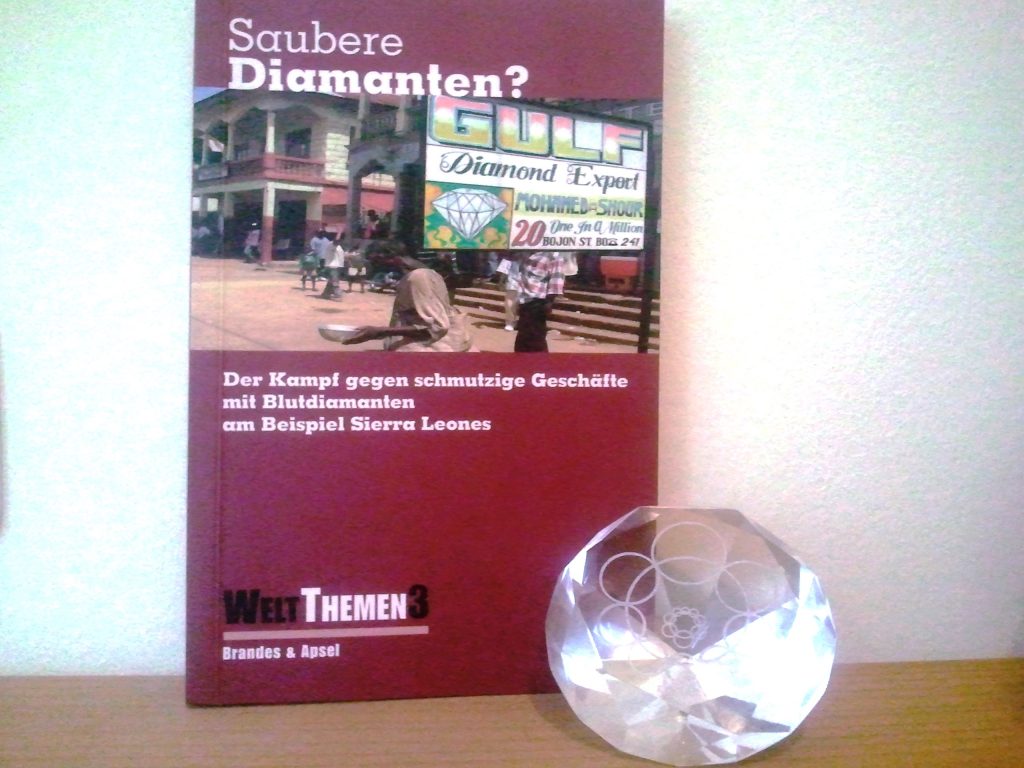„Naaa, wie waren deine Ferien?“, fragt meine Kollegin Susanne lächelnd. Ich senke meine Kaffeetasse. „Ach du“, sage ich und schaue dabei zum Fenster hinaus, wo dicke Regentropfen – vielleicht sind es auch…
„Naaa, wie waren deine Ferien?“, fragt meine Kollegin Susanne lächelnd. Ich senke meine Kaffeetasse. „Ach du“, sage ich und schaue dabei zum Fenster hinaus, wo dicke Regentropfen – vielleicht sind es auch Schneeflocken – gegen das Fenster klatschen, „abgesehen davon, dass mein Freund Schluss gemacht hat, ich einmal in der Notambulanz saß, ein anderes Mal der Notarzt mit Blaulicht kam und meiner Tante das Haus abgebrannt ist, ganz gut. Und deine?“ Sie starrt mich an und beginnt an ihrem Kugelschreiber herumzulutschen, als könne sie aus ihm eine angemessene Reaktion saugen. Natürlich bin ich mir im Klaren darüber, dass ihre Frage rhetorisch gemeint war, aber mir ist heute einfach mal nach Wahrheit. Zu anstrengend erscheint mir das Aufsetzen meiner Maske. Aber warum sind wir eigentlich so, wenn wir auf der Arbeit sind? Warum gibt es von uns eine private Version und eine, die dauerglücklich im Büro sitzen muss?
Da steht der Manager bei der Präsentation vor seinen Kollegen, ein Schatten seiner selbst, zeigt höchste Professionalität und in Wahrheit weint er innerlich um seine verstorbene Mutter. Die Kassiererin sitzt an der Kasse und jedes Mal, wenn jemand die Ritter Sport Alpenmilch kauft, schießt ein schmerzvolles Projektil voller Adrenalin mitten durch ihr Herz, weil sie an die strahlenden Augen ihres Ex-Mannes denkt, wenn sie ihm die Schokolade mitgebracht hat. „War beim Einkauf alles in Ordnung?“, fragt sie lächelnd, aber mit leeren Augen. Wir sitzen mit Liebeskummer am Arbeitsplatz und wenn uns der Kollege fragt, wie es uns geht, antworten wir: „Gut, danke.“ Heute habe ich mit meiner Antwort die natürliche Ordnung aus dem Gleichgewicht gebracht und genau das will mir Susanne auch zu verstehen geben, indem sie meint: „Oh verdammt, das tut mir leid. Na ja, wir reden später darüber, ich muss noch ein paar Sachen kopieren.“
Als ich nach der Trennung von meinem Freund die sechste Taschentuch-Box geleert hatte und die Ferien langsam dem Ende nahten, googelte ich, ob man sich wegen Liebeskummer krankschreiben lassen kann. Immerhin kann daraus das lebensbedrohliche Broken-Heart-Syndrom entstehen. Wegen Liebeskummer haben sich schon viele Menschen das Leben genommen. Warum also nicht zuhause bleiben und dem Kummer seinen Lauf lassen? Ich las Antworten wie „die eigene Gefühlslage hat im Job nichts verloren“ oder „Arbeit und Privatleben muss man trennen können“. Selbst die Süddeutsche Zeitung schreibt: „So weh eine Trennung auch tut – im Berufsalltag sollten private Probleme keine Rolle spielen.“* Nun saß ich vor meinem Laptop und eine einzige Frage schwirrte durch meinen Kopf: Warum eigentlich? Warum betreten wir jeden Morgen aufs Neue diese Bühne mit einem Lächeln, als hätten wir es uns mit Theaterschminke ins Gesicht gemalt und mit Haarspray fixiert? Warum ist es nicht in Ordnung, vor den Kollegen zu weinen? Und warum darf ich mich, wenn ich einen Beruf mit viel Kundenkontakt habe, nicht krankschreiben lassen, wenn ich Kummer habe?
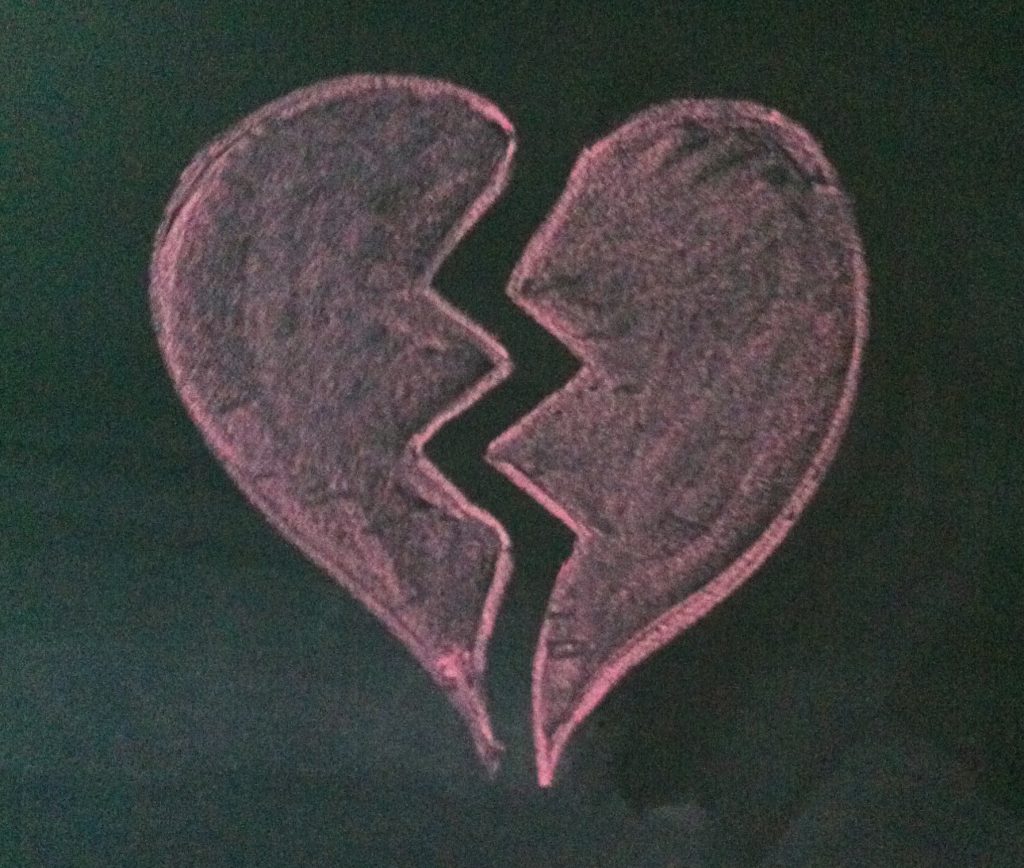
Keine zehn Minuten, nachdem meine Kollegin Susanne mich stehengelassen hat, betrete ich meine Bühne: Das Klassenzimmer 202. Mein Publikum: Die 5b. Während ich den Schlüssel in das Schloss stecke und die Meute hinter mir durch den Flur tobt, schminke ich mir innerlich mein Lächeln auf. „Guten Morgen, liebe 5b!“, sage ich, als wäre ich die gut gelaunte Mami mit der gut gelaunten Familie aus der gut gelaunten Lätta-Werbung. Den Schüler Michael, der in der letzten Reihe sitzt, kann ich an diesem Tag nicht aufrufen. Er heißt genauso wie mein Ex-Freund und ich will nicht riskieren, dass die Tränen mein Lächeln abwaschen. Die Kleinen kann ich täuschen, sie sind ohnehin zu beschäftigt mit dem Katzenskelett, das ich vorne auf den Tisch gestellt habe, sodass sie nichts von meinem gebrochenen Herzen sehen.
In der zweiten Stunde stehe ich vor der 10c. „Wie waren Ihre Ferien?“, fragt eine Schülerin. „Nicht so gut“, antworte ich jetzt ehrlich, weil ich schlecht lügen kann. „Warum nicht?“, fragt sie mit großen Augen und ich erkläre kurz die Lage, ähnlich wie ich es bei Susanne getan habe. Die Klasse hört zu, bekundet danach ihr Mitgefühl und ist an diesem Tag ganz besonders ruhig und zeigt sich ausgesprochen freundlich. So brav waren sie das letzte Mal gewesen, als ich eine Lehrprobe hatte. „Es tut mir leid, dass ich eure Klassenarbeiten noch nicht korrigiert habe“, entschuldige ich mich am Ende der Stunde. „Das ist nicht schlimm, wir brauchen die nicht so dringend zurück“, antwortet Florian, der sonst ganz still ist und sich nie meldet. „Vielleicht sollten Sie am Wochenende auch lieber mal wegfahren als unsere Arbeiten zu korrigieren“, ergänzt Paul, ein Schüler, mit dem ich seit Wochen Auseinandersetzungen habe. „Und übrigens“, wirft jetzt noch Luis ein, „der Typ muss ein ganz schöner Idiot sein, wenn er Sie verlässt.“ Durch die Klasse geht eine Welle von „Ja, genau!“ und „Aber wirklich!“. Beim Verlassen des Klassenzimmers muss ich lächeln. Es ist ein echtes Lächeln, das meine Schüler mir aufs Gesicht zaubern. Und auch, wenn sie in dieser Stunde vielleicht nicht ganz so viel über die Struktur der DNA gelernt haben, so haben sie gelernt, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein und Schwäche zu zeigen. Das ist vermutlich mehr als man ihnen in ihrer ganzen Schullaufbahn je beigebracht hat. Was aber habe ich in dieser Stunde gelernt? Nicht das, was mir mein erster Chef während meiner Ausbildungszeit beigebracht hat, nämlich Professionalität. Ich habe etwas ganz anderes und viel Wertvolleres gelernt: Nur wenn man selbst Menschlichkeit zeigt, kann man Menschlichkeit erfahren.

Einer Kassiererin, die mir ihre Traurigkeit zeigt, würde ich sicher ein paar tröstende Worte spenden. Vielleicht würde aber auch ihr Chef sagen: „Bleiben Sie besser zuhause und erholen sich ein paar Tage.“ – wenn sie ihn nur fragte. Natürlich kann man einwenden, dass Arbeit auch ablenkt, aber manchmal muss man dem Herz Zeit geben, zu heilen und diese Zeit muss man sich zugestehen. Glück ist kein Zufall, es ist eine Wahl, die jeder Einzelne von uns hat. Aber ich strebe nach Authentizität, das gilt auch für das Glücklichsein.
Während meiner Meditation am Nachmittag überkommt mich bei den Gedanken an meine zehnte Klasse ein ganz leichtes, aber sehr warmes Gefühl von echtem Glück. Ein Glücklichsein, das erst durch eine Fremd- und daraus folgend durch eine Selbstbejahung ausgelöst wurde. Meine Schüler haben mich dazu gebracht, zu mir selbst und meinen Gefühlen zu stehen, kurz: Es macht mich glücklich, unglücklich sein zu dürfen. Ich werde bald wieder fröhlich vor meiner 10c stehen, aber dann werden die Schüler wissen, dass mein Lächeln echt ist, weil ich bei der Maskerade des Glücklichseins nicht mehr mitspiele.
Am Abend erreicht mich eine WhatsApp-Nachricht von Susanne. „Wie geht’s dir?“, fragt sie mit einem lächelnden Emoticon dahinter – dieses Mal weiß ich, dass die Frage nicht rhetorisch gemeint und das Emoticon ein echtes Lächeln ist.
* sueddeutsche.de/karriere/beruf-und-private-probleme-wie-man-sich-bei-liebeskummer-im-job-verhaelt, 13.1.2016