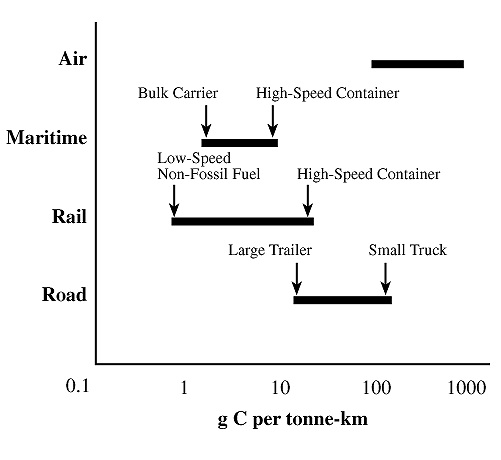Burma boomt. Jedes Mal, wenn ich von vollen Hotels und Guesthouses abgewiesen wurde, bekam ich das zu spüren. Wie stark sich die Zahl der Touristen tatsächlich erhöht hat, erfuhr ich…
Burma boomt. Jedes Mal, wenn ich von vollen Hotels und Guesthouses abgewiesen wurde, bekam ich das zu spüren. Wie stark sich die Zahl der Touristen tatsächlich erhöht hat, erfuhr ich aber erst am letzten Tag in einem amerikanischen Restaurant in Mandalay. Hier lag eine Zeitschrift mit den Besucherstatistiken der ersten sieben Monaten dieses Jahres herum. Rund 300.000 Menschen, zum größten Teil aus asiatischen Ländern, reisten demnach in Myanmar ein. Das sind ganze 37,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Schweizer wie ich machen pro Monat etwa hundert Einreisen aus – Deutsche rund zehn Mal mehr.
Soweit die Zahlen. Doch was sind die Gründe, dass das Land plötzlich so beliebt wurde? Ich mache die Probe aufs Exempel und frage den einsamen Touristen am Nebentisch. James Blumenthal ist knapp 30 Jahre alt, stammt aus New York und will im nächsten Jahr ein eigenes Goldhandelsunternehmen gründen. Weil er weiß, dass es sich dann bald ausgereist hat, erkundet er vorher noch schnell die Welt. „Ich wollte schon immer nach Myanmar,“, erzählt er, „aber erst seit Aun Dingsda Präsidentin wurde, ist es wieder politisch korrekt, das Land zu besuchen.“ Hier irrt er sich.
Politisch korrekt
Die Frage nach dem richtigen Verhalten beschäftigt Myanmar-Reisende seit die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi vor ein paar Jahren zu einem touristischen Boykott des Landes aufgerufen hat. Und mich beschäftigte die Frage besonders, seit ich gebeten wurde, einen Gastbeitrag über meine zweiwöchige Rucksackreise zu verfassen.
Was hat sich also verändert, seit Reisen in die Militärdiktatur nicht opportun waren? Zunächst eher wenig. Aung San Suu Kyi wurde vor zwei Jahren aus dem Hausarrest entlassen und durfte sich im Frühling 2012 ins Parlament wählen lassen. Das mag fürs Land ein bedeutender Schritt sein, er darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Militärjunta noch immer fest im Sattel sitzt. Wer das Land vor zwei Jahren nicht bereisen wollte, dürfte dies eigentlich auch heute nicht tun, es sei denn, er wolle die Regierung für die zaghaften Öffnungsversuche belohnen.
Die Frage ist indes, ob ein Fernbleiben überhaupt etwas bringt? Lonely Planet rechnet in seinem neusten Reiseführer vor, dass bei einer zweiwöchigen Individualreise für rund 420 Dollar zwischen einem Viertel und einem Fünftel in die Regierungskassen gespült wird. Der Rest kommt den Menschen zu Gute. Ich habe unterwegs mit Einheimischen über das Thema geredet. Zwar habe ich auf Grund meines Status als Reisender natürlich besonders häufig Menschen kennengelernt, die direkt vom Tourismus profitieren. Doch generell scheint mir, dass sich die meisten über die Zunahme der Besucher freuen. Viele Menschen können an den Reisenden schließlich etwas verdienen: Seien das die Besitzer von kleinen Pensionen oder auch bloß einfache Ladenbesitzer, die hin und wieder für 300 Kyat (Anm.: Rund 0,26 Euro) eine Flasche Trinkwasser verkaufen können.
Nachhaltig reisen
Eine andere Frage ist jedoch, wie nachhaltig man sich auf einer Myanmarreise verhalten kann. Weil mir das persönlich wichtig ist, habe ich in einem lokalen Reisebüro in Kalaw ein dreitägiges Trekking zum Inle See gebucht. Es hieß, wir würden durch mehrere abgelegene Minderheitendörfer wandern. Für mich war das nicht nur eine touristisch attraktive Alternative zu einer weiteren Rüttelfahrt im Bus. Es war auch etwas fürs soziale Gewissen, konnte ich doch einen Teil meiner Ausgaben in einem wirtschaftlich kaum erschlossenen Gebiet tätigen.
Die Realität sah jedoch anders aus. Damit der Tour-Operator seinen Gewinn optimieren konnte, aßen wir in den Dörfern nicht etwa bei den Einheimischen, sondern wir hatten einen Koch von der Trekking-Agentur dabei, der jeweils mit dem Auto zur nächsten Etappe fuhr und für uns kochte. Von zwei Reiseführern, die mit uns mit kamen, bekam einer überhaupt keinen Lohn. Grund: Er befindet sich noch im Ausbildung und muss zwei Monate lang jede Woche das Trekking mitlaufen, bis er den Weg gut genug kennt, um einer eigenen Gruppe den Weg zu weisen. In Dörfern durften wir nie länger bleiben. Schließlich sollten wir ja am Ende die Souvenirs bei einem Laden kaufen, der Provisionen auszahlt.
Auch wenn die Bilanz an vielen Stellen nicht besonders gut ausfällt sind Besuche des Landes trotzdem wertvoll. Myanmar gehört zu den Ländern mit der stärksten Medienzensur. In den vielen persönlichen Gesprächen, die man mit den oft sehr neugierigen Menschen führen kann, übermittelt man ein Wissen über das Weltgeschehen, das den Einheimischen teilweise vorenthalten wird. Letztlich spricht für ein Besuch jedoch vor allem eines: Myanmar ist ein unglaublich spannendes und facettenreiches Reiseland mit ausgesprochen freundlichen Menschen.
Oliver, der Autor dieses Gastbeitrages, ist 37 Jahre alt und freier Journalist und Herausgeber des Weltreiseforums. Er lebt seit mehreren Jahren in Peking und unternimmt von dort aus regelmäßig Reisen in alle Ecken Ostasiens. Im Oktober 2012 besuchte er zum ersten Mal für zwei Wochen Myanmar. Die Route führte ihn durch das Dreieck Mandalay – Bagan – Inle-See.